Landesgeschichtliche Einordnung
Autor: Dr. Udo Bayer (Arbeitskreis RP Tübingen)
Druckversion
Zur Geschichte der Juden in Baden und Württemberg
Eine knappe Zusammenfassung der jüdischen Geschichte auf dem Gebiet eines erst
1952 entstandenen Bundeslandes muss, außer der Territorialgeschichte der
beiden unter Napoleon geschaffenen Hauptländer, noch mindestens die in ihrer
historischen Entwicklung ganz heterogenen Gebiete der Reichsstädte,
Hohenzollern, ursprünglich kurpfälzische Teile, Vorderösterreich und die
kleinen, v. a. reichsritterschaftlichen Herrschaften einbeziehen. Lokale oder
regionale Museen fokussieren die Aufmerksamkeit selbstverständlich nur auf
Ausschnittsbereiche. Man muss auch festhalten, dass die Geschichte der Juden in
Deutschland nicht auf die NS-Zeit reduziert werden kann. Vermutlich ist das 19.
Jh. die entwicklungsgeschichtlich wichtigste Periode; schließlich ist es
bemerkenswert, dass der jüdische Anteil an der Gesamtbevölkerung konstant um
nur etwa 1 % schwankte. Zu Baden und Württemberg gehören nur gut 7 % der
deutschen Juden insgesamt. An entscheidenden innerjüdischen Entwicklungen wie
der Aufklärung hat der Südwesten wenig Anteil. Bezug und Hintergrund für
Regionalentwicklungen ist immer die Geschichte der deutschen Juden allgemein,
insbesondere die von Meyer/Brenner herausgegebene umfassende Gesamtdarstellung.
Die im Mittelalter fixierte Situation der jüdischen Bevölkerung galt für
Jahrhunderte. Bis Ende des 11. Jh. bestanden jüdische Gemeinden in politischen
und wirtschaftlichen Zentren meist nicht als räumlich abgesonderte
Viertel. In unserem Gebiet sind als älteste Gemeinden für das 11. Jh.
Heilbronn und Schwäbisch Hall anzusetzen (Konstanz hatte möglicherweise bereits
zur Römerzeit jüdische Bewohner), im Badischen Grünsfeld und Wertheim.
Wirtschaftliche Basis waren Fernhandel und Bankgeschäfte. Die Juden standen
außerhalb der Feudalgesellschaft. Das Aufblühen der Städte mit erstarkender
Zunftkonkurrenz hatte für sie die Abdrängung in den lokalen Kleinhandel und die
Pfandleihe zur Folge. Innerchristliche Entwicklungen (Bettelorden, Kreuzzüge,
IV. Laterankonzil 1215) ließen die Feindschaft gegen die Juden wachsen,
Ritualmord- und Hostienfrevelbeschuldigungen halten sich bis ins 19. Jh.
Den theologischen Rahmen der christlichen Einschätzung des Judentums bildete
die Substitutionsthese, nach der die Kirche die Stelle des Volkes Israel und
seiner Heilszusagen eingenommen hat. 1215 wird auf dem IV. Laterankonzil die
Kennzeichnung der Juden durch besondere Kleidung dekretiert; sie bleibt
teilweise bis in Schutzverträge des 18. Jh. in Kraft.1239 wurde der Talmud auf
den Index gesetzt. Der vom Papst 1205 herausgestellte Begriff der
Judenknechtschaft und die sich hieraus unter Friedrich II. entwickelnde
Rechtsinstitution des "Kammerknechts" beschleunigte ganz entscheidend
die Entrechtung bis hin zum Status einer Randgruppe; die Juden wurden quasi
verstaatlicht; Freizügigkeit und das Recht des Waffentragens wurden ihnen
entzogen. Folgenreich war die Veräußerung des Judenregals an andere
Machtträger, Reichsstädte und Territorialherrn, vor allem unter Karl IV. Der
ursprüngliche Judenschutz wurde so zur Ausbeutung; die Judensteuer stellten den
größten Posten der kaiserlichen Einkünfte dar. Einen weiteren Höhepunkt der
Verfolgung - nach den Kreuzzügen - bildete die Pestzeit Mitte des 14. Jh. mit
der Auslöschung der meisten Gemeinden.
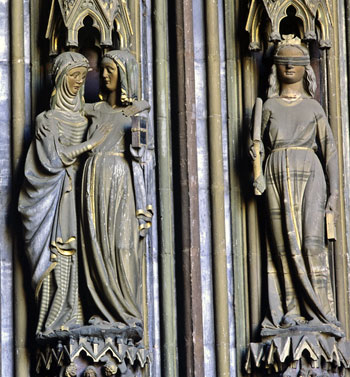
Figurengruppe am Hauptportal des Freiburger Münsters (spätes 13. Jh.):
Heimsuchung (Maria und Elisabeth) und Symbolfigur der Synagoge (Augenbinde,
Stab)
©
www.lmz-bw.de

Karlsruher Thorarolle, mutmaßlich die älteste Seferthora Badens (wohl 13. Jh.)
©
www.lmz-bw.de
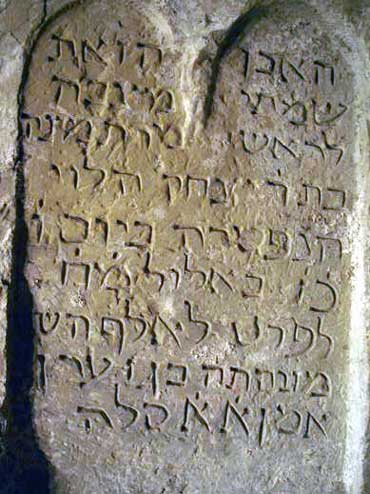
Grabstein der Mina (1288) aus der seit 1233 nachweisbaren jüdischen Gemeinde in
Ulm: "Diesen Stein stellte ich als Grabmal zu Häupten der Frau Mina, Tochter
des Herrn Jizchak HaLewi. Sie verstarb am 6. Tag [Freitag], den 27. Elul 48
[27.08.1288] im 6. Jahrtausend. Ihre Ruhe sei im Garten Eden. Amen, ich sage
sela."
© Udo Bayer
Karl IV. verlieh auch den beiden württembergischen Grafen 1360 das
Judenschutzrecht; in Form vertragsähnlicher Schutzbriefe wurden seitdem
und bis ins 18. Jh. Niederlassung und Erwerbstätigkeit festgelegt. Württemberg
schränkte die kündbaren Rechte bald wieder ein, und Eberhard im Bart
verschlechterte in seiner Landesordnung von 1495 die Erwerbsmöglichkeiten
weiter; sein Testament legte sogar den Ausschluss der Juden als
"schädliche Würm" aus seinem Territorium fest, ein Landesgesetz von 1498 bis
1806. Allerdings war ab 1551 gegen Geleitgeld ein Betreten des Territoriums
möglich. Zu unseren wenigen mittelalterlichen Bauzeugnissen gehört eine Mikwe
in Offenburg.
Die endgültige Ausweisung der Juden aus fast allen Reichsstädten (z. B. Ulm
1499) führte zur Ausbildung des Landjudentums als bis ins 19. Jh.
charakteristischer Lebensform der deutschen Juden - fern der Entwicklung des
städtischen Lebens. Die Sicherheit der Juden hing allein vom Interesse des
Territorialherrn oder der Stadt ab. Judenordnungen ermöglichten als gewissen
Rechtsschutz die Anrufung des Reichskammergerichts. Die Kurpfalz vertrieb ihre
Juden 1391, Vorderösterreich 1574. Gelegentlich wechselten sich Vertreibung und
Wiederzulassung aus wirtschaftlichen Gründen ab wie in den beiden badischen
Markgrafschaften. Die Vertreibungen hielten aber bis in das 17. Jh. an, so auch
in Hohenzollern-Hechingen, wo Juden erst wieder 1701 einen Schutzbrief
erhalten.

Blick auf Hechingen mit Brücke und Häusern mit Synagoge im Vordergrund
©
www.lmz-bw.de (Jaeger)

Ehemaliger jüdischer Freidhof am Waldenberg in Neckarsulm (2008): Grabsteine
mit hebräischen Inschriften, im Hintergrund Tahara-Haus
©
www.lmz-bw.de (Rachele)
Der Frühabsolutismus mit dem Merkantilismus und das Ende des
30-jährigen Krieges waren insofern ein Einschnitt für die Geschichte der Juden
auch in unseren Territorien, als der Status des Kammerknechts endete und eine
kleine Gruppe von Juden mit privilegierter Position entsteht, die Hofjuden
oder Hoffaktoren. Abhängig vom Territorialherrn, misstrauisch von den
Ständen beobachtet, kennzeichnen ihre Stellung Risikobereitschaft, gute
auswärtige Verbindungen und weit verzweigte verwandtschaftliche Kontakte.
Gleichzeitig werden sie gerne als verantwortliche Vorsteher der Juden des
Territoriums eingesetzt. Pacht von Monopolen und nichtzünftige Manufakturen
sind neben Kreditgeschäften ihr Betätigungsfeld. Die interessantesten Beispiele
für Württemberg sind Josef Süß Oppenheimer (hingerichtet 1738) und die
Kaulla-Familie. Sie errichtete in Hechingen 1803 eine bedeutende Talmud-Schule.
Die Hoffaktoren und ihre Bediensteten fielen nicht unter das
Ausschließungsgesetz; entsprechendes galt für die zum herzoglichen Kammergut
gehörenden Orte. Ziel der frühneuzeitlichen Judenordnungen war generell die
Bekehrung als Konsequenz aus der angeblichen Verderbtheit der jüdischen
Religion. In Hohenzollern-Haigerloch z. B. wurden die Juden noch Mitte des 18.
Jh. gezwungen, jedes Vierteljahr eine Predigt anzuhören.
Mannheim und Karlsruhe bieten im 18. Jh. besondere
Entwicklungsmöglichkeiten. 1660 bietet der Kurfürst großzügige
Ansiedlungsbedingungen mit der Pflicht zum Hausbau, die Verlegung der Residenz
nach Mannheim ab 1720 führt zum höchsten je erreichten jüdischen Anteil an der
Bevölkerung. Zur gleichen Zeit versucht der Markgraf in Karlsruhe auf ähnliche
Weise die Bauausgestaltung zu fördern. Aber weit über 90% der Juden waren
Anfang des 19. Jh., in dem sich ihre Stellung in Deutschland ungeahntem Maße
wandeln sollte, Landjuden und nahezu ausschließlich im Handel tätig. Immerhin
die Hälfte lebte unter dem Existenzminimum; ein Viertel schließlich bildete
sogar die Unterschicht der Betteljuden. Die neuere jüdische Geschichte verläuft
in Deutschland territorial und schichtspezifisch recht unterschiedlich.
Die staatliche Umgestaltung der napoleonischen Zeit, die Teilnahme jüdischer
Freiwilliger an den Befreiungskriegen und antiemanzipatorische Bestimmungen des
Wiener Kongresses charakterisieren die Ausgangslage zunehmender Emanzipation
im ersten Drittel des 19.Jh. In Baden wirken Reformideen (wie der 1801
veröffentliche Bericht Holzmanns "Über die bürgerliche Verbesserung der Juden")
früher als in Württemberg: Durch die Restriktionen seien die Juden zu dem
gemacht, was sie sind, erlaubte Nahrungszweige sollten ihre wirtschaftliche
Existenz ermöglichen, aber noch ohne Zugang zu öffentlichen Ämtern.
Das Konstitutionsedikt von 1807, also zu napoleonischer Zeit, machte sie in
Baden zu Staatsbürgern, aber von der Legislative noch ausgeschlossen und am
Wohnort blieben sie im Status des Schutzbürgers. 1809 richtete der Staat eine
Kirchenverfassung ein, später regelte er auch die Ausbildung der
Rabbiner und ihre Amtstracht (sie wurden Staatsbeamte) und versuchte auf die
Berufsausbildung Einfluss zu nehmen, indem er, wie ab 1828 dann in Württemberg,
landwirtschaftliche und handwerkliche Tätigkeit fördern wollte. Die Verfassung
von 1818 fixierte den praktischen Ausschluss von Staatsämtern und vom passiven
Wahlrecht. Die jüdische Bevölkerungszahl in Baden betrug über 17.000, die in
Württemberg etwa 10.000.

Synagoge in der Kronenstraße in Karlsruhe, erbaut 1798-1806, abgebrannt 1871 (Lithografie
um 1830)
©
www.lmz-bw.de

Synagoge in der Karl-Friedrich-Straße in Karlsruhe, erbaut 1881, zerstört 1938
(ca. 1900)
©
www.lmz-bw.de
Württemberg musste schon deswegen das formal noch geltende
Ausschließungsgesetz durch eine einheitliche rechtliche Festlegung der Stellung
der Juden ablösen, weil sein Gebietszuwachs Territorien umfasste, in denen
jüdische Gemeinden mit verbrieften Schutzrechten bestanden, die nun Angehörige
des neuen Staates waren. König Friedrich stand den Juden positiver gegenüber
als seine Beamten. Einzelverordnungen erlaubten den Erwerb selbstbebauten
Landes und den Zugang zu bürgerlichen Gewerben (1809) sowie die Aufhebung des
Leibzolls, des Schutzgelds, legten aber auch die Beschränkung der Niederlassung
auf Orte fest, wo schon vorher Juden ansässig waren, richteten israelitische
Konfessionsschulen ein und machten die männlichen Juden wehrpflichtig. Fremden
Betteljuden war das Betreten des Landes verboten. Die Identifikation mit dem
neuen Staat wuchs in der jüdischen Bevölkerung. Die Mehrheit der christlichen
Bevölkerung lehnte Jahrzehnte lang eine rechtliche und soziale Besserstellung
der Juden ab, was sich auch bei dem Gesetz von 1828 deutlich zeigte; der
Ravensburger Stadtrat sprach gar von der "jüdischen Pest". Das Dilemma der vom
Staat ausgehenden Emanzipationsbestrebungen liegt darin, dass die
württembergischen Regelungen den Juden den Handel abgewöhnen wollten ohne
entsprechende Erweiterung ihrer beruflichen Betätigungsrechte.
Dennoch brachte das "Gesetz in Betreff der öffentlichen Verhältnisse der
israelitischen Glaubensgenossen" von 1828, in vielem an der vorangegangenen
badischen Gesetzgebung orientiert, gewisse Verbesserungen (Aufhebung des
Schutzjudenverhältnisses, einheitliche Landesorganisation mit
Oberkirchenbehörde, staatliche Konfessionsschule und Rabbiner- und
Lehrerausbildung, allerdings mit Einschränkung der traditionellen
Rabbinerbefugnisse); ab 1838 durfte nur in den von der Staatsbehörde
anerkannten Synagogen öffentlicher Gottesdienst gehalten werden. Die
Niederlassung ist an die Gewährung des Ortsbürgerrechts gebunden. Insgesamt
wird von Staats wegen quasi ein neues religiöses Paradigma installiert für eine
kirchenanaloge "Cultus-Gemeinde". Die wirtschaftliche Betätigung blieb
eingeschränkt; die Eröffnung von Ladengeschäften ist genehmigungspflichtig; v.
a. der Schacherhandel wird beschränkt. Immer noch lebten gut 80% vom
Schacherhandel, d.h. einem Handel nicht mit speziellen Wirtschaftsgütern,
sondern mit allem, was überhaupt Tauschwert hatte. Auch Pfandleihe und
Viehverstellen wurden hierzu gerechnet. Auf dem Land waren die Juden quasi der
Bankier des verschuldeten Bauern, des schlechten Risikos. Ein Antrag auf
Aufnahme ins Bürgerrecht konnte nach 10 Jahren Tätigkeit in Feldbau oder
Handwerk gestellt werden. Biografische Selbstzeugnisse existieren aus dieser
Zeit kaum.
Für die Mehrheitsgesellschaft war Handelstätigkeit schon deswegen minderwertig,
weil ihr Arbeitsbegriff mit physischer Anstrengung verbunden war; Handel galt
als unproduktiv und sogar unmoralisch. Bemerkenswert ist auch, dass
andererseits Hausieren sich keineswegs auf Juden beschränkte, sondern allgemein
eng mit der handwerklichen und der landwirtschaftlichen Produktion verbunden
war; aber der jüdische Händler blieb durch den alten Topos der angeblich
schlechten Charaktereigenschaften und des "Parasitentums" gebrandmarkt.
Wirtschaftlich bedeutend für die südwestdeutschen Landjuden wie für ihre
Geschäftspartner war der Viehhandel, teilweise mit Kreditgeschäft verbunden.
Pferdehändler stellten die ländliche Elite dar. Der natürliche wirtschaftliche
Interessengegensatz in einem Geschäft mit durchaus symbiotischen Zügen wurde
immer wieder einseitig dem Kollektiv der Juden angelastet, letztlich bis in die
NS-Zeit.

Ehemalige Synagoge in Wallhausen-Michelbach an der Lücke (2004), erbaut 1757,
eines der ältesten erhaltenen jüdischen Gotteshäuser in Württemberg
©
www.lmz-bw.de (Weischer)

Betsaal der Synagoge in Michelbach (2004)
©
www.lmz-bw.de (Weischer)

Jüdische Viehhändler verhandeln mit einem Bürger, Figurengruppe (Terrakotta)
aus Zizenhausen (frühes 19. Jh.)
©
www.lmz-bw.de/Badisches
Landesmuseum
Die Berufsumschichtung gelang nicht im erwünschen Maß, zumal die
Bedeutung des Handwerks und auch längerfristig die der Landwirtschaft
zurückging. Außerdem waren religiöse Vorschriften bei christlichen Meistern oft
nicht einzuhalten. Generell standen offensives und retardierendes
Wirtschaftsverhalten zunehmend im Konflikt; die Juden entwickelten in der ihnen
seit langem zugewiesenen Wirtschaftstätigkeit des Handels die Neuerungen, die
ihnen wegen ihrer Distanz zur umgebenden Wirtschaftsgesellschaft leichter
fielen und die sie alsbald in Konflikt mit der traditionell orientierten
christlichen Konkurrenz brachten. Auch das Gespür für konjunkturelle
Entwicklungen und der Grad der zu erwartenden Diskriminierung spielten bei der
Berufswahl eine Rolle. So hatten die Juden einen Vorsprung an Modernität und
Flexibilität. Universitäten durften Juden in Württemberg seit 1819 besuchen;
Baden und Württemberg erlaubten als erste Staaten jüdische Anwälte und Ärzte,
von Universitätspositionen blieben sie aber bis in die zweite Jahrhunderthälfte
ausgeschlossen.
In Hohenzollern vollzog sich die bürgerliche Gleichstellung langsamer; die
Erteilung bürgerlicher Rechte für die Juden in Sigmaringen wurde wegen des
Einspruchs der Landesdeputation in Hechingen nicht übernommen, sodass für sie
der anachronistische Status von Schutzjuden mit dem Ausschluss von
Gewerbetätigkeit bis zum Übergang an Preußen 1850 erhalten blieb, obwohl Juden
ein Viertel der Bevölkerung ausmachten. Auch an diesem Einspruch wird, wie in
Württemberg, der vorherrschende hartnäckige ländliche und kleinstädtische
Widerstand gegen den sozialen Aufstieg der Juden deutlich. Umso größer ist die
wirtschaftliche Dynamik, die jüdische Unternehmensgründer nach der
Jahrhundertwende zeigen. Allein zwei Drittel der deutschen Juden lebten
übrigens in Preußen, woran greifbar wird, dass unser hier betrachtetes
Territorium innerhalb der deutsch-jüdischen Geschichte nur einen relativ
kleinen Ausschnitt bildet.
In der Beziehung von jüdischer Minderheit und christlicher Mehrheit auf
dem Land galt, wie Jeggle betont, allenfalls eine nur vorgetäuschte Eintracht
und "bourgeoise Idylle und blutiges Chaos" stehen sich gegenüber; 1819 und die
Zeit der 48iger Revolution mit der kurzzeitigen Geltung der Grundrechte sind
hier besonders markante Einschnitte. Während der Krawalle 1819 quartierte sich
der badische Großherzog als symbolische Geste sogar im Haus eines prominenten
Karlsruher Juden ein. Neun der Abgeordneten der Paulskirchenversammlung waren
Juden; die Juden wurden sowohl für die Revolution wie für die Reaktion
verantwortlich gemacht und die vollständige Emanzipation ließ noch bis 1862
(Baden) bzw. 1864 (Württemberg) wegen des Widerstands der zweiten Kammern auf
sich warten. Der badische Minister Lamey argumentierte 1860, eine gänzliche
Emanzipation sei nötig, da nicht eine Gruppe von Untertanen wegen der Religion
von Rechten ausgeschlossen werden könne. Es sind vier badische Städte, die als
letzte in Deutschland jetzt erst Juden die Niederlassung erlauben (Freiburg,
Konstanz, Offenburg, Baden-Baden), während Württemberg die Freizügigkeit 1851
anerkennt. In Baden erhält andererseits 1868 der erste Jude in Deutschland ein
Ministeramt, nämlich Finanzminister Ellstätter.

Ehemalige Synagoge in Sulzburg (1995), erbaut 1823
©
www.lmz-bw.de
Bei der Auswanderung nach Amerika waren Juden dreifach
überrepräsentiert; deutsche Juden hielten der alten Heimat viel länger die
Treue als jüdische Einwanderer aus anderen Ländern - ein wichtiges Beispiel ist
der Hollywoodpionier Carl Laemmle. Die Binnenwanderung in die größeren
Städte und damit der Rückgang des Landjudentums sind die vornehmlichen
demographischen Entwicklungsmerkmale, in Süddeutschland allerdings etwas
verlangsamt. Für die Mehrheit der deutschen Juden ist die Zeit zwischen 1848
und der Reichsgründung eine Periode des wirtschaftlichen Erfolgs und des
sozialen Aufstiegs, verbunden mit der Urbanisierung, bei der Württemberg
allerdings unter dem Reichsdurchschnitt lag; so entstehen auch in den
ehemaligen Reichsstädten wieder größere Judengemeinden trotz Versuchen, die
Ausschließung von Juden auch unter württembergischer Herrschaft beizubehalten.
Die Binnenwanderung der auf dem Land lebenden Juden vollzog sich nach Schaffung
des Eisenbahnnetzes teilweise in Etappen über einen nahe gelegenen Ort mit
Bahnanschluss und die Einrichtung eines Ladengeschäfts.
Die jüdische Bevölkerungsgruppe trägt wie keine andere Gruppe zur
Modernisierung der deutschen Wirtschaftsgesellschaft bei; hierbei spielen
Aufstiegswille und Bildungsbereitschaft eine wichtige Rolle. Die Reform des
Bildungswesens wurde zu einem wichtigen Faktor der umfassenden Akkulturation;
dieser kultursoziologische Begriff will das Hineinwachsen in eine gemeinsam
gestaltete Lebenswelt verdeutlichen, ohne die Differenz christlicher und
jüdischer Lebenswelten aufzuheben. Der bislang herrschende schlechte
Bildungsstand der Juden war gleichzeitig Mitursache und Symptom für ihre
Isolation. Insbesondere in der Textilbranche war der Übergang vom Handel zur
industriellen Produktion aus verschiedenen Gründen einfacher; in Württemberg
und Hohenzollern gibt es bestimmte Schwerpunkte für diese Entwicklung
(Göppingen, Reutlingen). Zu Beginn des 20. Jh. ist die Zahl der jüdischen
Studenten reichsweit fünffach höher. Inwieweit das Urteil von Monika Richarz
für die sich herausbildende deutsch-jüdische Oberschicht für unser Territorium
allgemein zutrifft, nämlich dass sie nie wirklich gesellschaftlich akzeptiert
war, ist schwer zu entscheiden. Das zeigt sich insbesondere an dem persönlich
geadelten Kilian von Steiner (1833-1903), der mit anderen jüdischen
Bankiers drei Jahrzehnte die Geschäftspolitik der Württembergischen Vereinsbank
und somit ihre Rolle bei der Industrialisierung Württembergs und auch Badens
maßgeblich mitbestimmte. Steiner gehört außerdem zu den Gründern der liberalen
Deutschen Partei und er ist Mitinitiator und erster Mäzen des Schillerarchivs
in Marbach. Der Großbürger Steiner ist ein extremer Beleg der These von Elon,
die eigentliche Heimat der deutschen Juden sei die deutsche Kultur und Sprache
gewesen und ihre eigentliche Religion das bürgerliche Bildungsideal.
Andere wichtige jüdische Persönlichkeiten der südwestdeutschen
Wirtschaftsgeschichte sind dann im 20. Jh. Otto Hirsch (u. a. Neckar-AG),
Eduard Ladenburg und die Karlsruher Bankiers Homburger und Straus sowie Alfred
Blumenstein.

Mausoleum des aus Steinsfurt stammenden Hermann Weil (+ 1927) in Waibstadt, der
mit seinem in Argentinien erarbeiteten Vermögen karitative Projekte im
Kraichgau unterstützte.
© Schulenübergreifende Projektgruppe "Judentum im Kraichgau" (
http://www.rsw.hd.bw.schule.de/shal/sha0.htm)
Eigenartigerweise sind aus unserem Land zur Kaiserzeit insgesamt relativ wenige
große Namen der deutsch-jüdische Kultur zu nennen, was wohl auch mit der
erwähnten quantitativen Gewichtsverteilung innerhalb des Reichs zusammenhängt.
Ein bedeutender jüdischer Schriftsteller dieser Zeit aus Württemberg ist
Berthold Auerbach aus Nordstetten, der Judentum und Integration in die
deutsche Gesellschaft verband. Zu nennen sind auch die Schriftsteller Alfred
Mombert und Jacob Picard; ebenfalls aus Baden stammen die beiden
Nobelpreisträger Fritz Haber und Richard Willstätter. Albert Einstein
stellt im 20. Jh. eine überragende Gestalt des geistigen Lebens dar; in den
Angriffen auf seine Person manifestiert sich gleichzeitig der aufkommende
Antisemitismus.
Die Stuttgarter Gemeinde, entscheidend geprägt von Oberkirchenrat Joseph
(von) Maier, war ausgesprochen fortschrittlich und liberal; Maier hatte bei der
Synagogeneinweihung 1861 verkündet: "Stuttgart ist unser Jerusalem", was den
Grad der Identifikation mit der Heimat und den Abstand von der Tradition zeigt.
Außerdem repräsentiert Maiers Person das - neben der Gleichstellung - zentrale
andere Thema des jüdischen Selbstverständnisses dieses Jahrhunderts, nämlich
die innerreligiöse Entwicklung. Der Liberalisierungsprozess führte zur
Abspaltung der Orthodoxie in den siebziger Jahren. Einige Gemeinden wie etwa
Niederstetten blieben orthodox. So spiegelt die Entwicklung in unserem
Territorium auch die Herausbildung der religiösen Hauptrichtungen in
Deutschland.
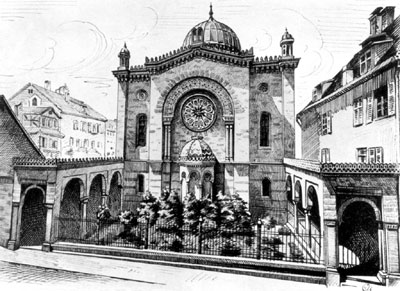
Synagoge in Stuttgart (Hospitalstraße 38), eingeweiht 1861, abgebrannt 1938
(Federzeichnung/Holzstich um 1861)
©
www.lmz-bw.de (Jaeger)
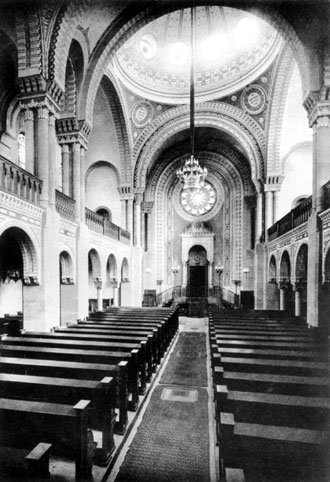
Innenraum der Stuttgarter Synagoge (1910)
©
www.lmz-bw.de (Bothner)

Gesetzestafeln der Stuttgarter Synagoge
©
www.lmz-bw.de (Jaeger)
Auf dem Land bleibt eine gewisse Distanz zwischen
Christen und Juden auch im Zeitalter der Emanzipation bestehen, teilweise
verschärft durch Agrarkrisen wie in den siebziger Jahren - trotz
Gemeinderats-Tätigkeit und Vereinsmitgliedschaften; sie zeigt sich etwa am
traditionellen Verhalten der Partnerwahl und am Wohn- und Lebensstil sowie der
Bildungsorientierung der jüdischen Mittelschicht. Konversionen zum Christentum,
quantitativ durchaus erheblich und immer noch als "Entreebillet" in die
Gesellschaft betrachtet und insbesondere immer noch Voraussetzung für den
Offiziersberuf, betrafen eher das großstädtische Bürgertum. (Da das badische
Armeekorps dem preußischen Heer eingegliedert war, galten übrigens die
diskriminierenden Restriktionen für Reserveoffiziere auch hier.)

Synagoge in Laupheim (Aquarell Stumpp)
© Stadt Laupheim

Schloss Großlaupheim - heute "Museum zur Geschichte von Christen und Juden in
Laupheim"
© Stadt Laupheim/Udo Bayer
Man kann feststellen, dass antijüdisches Ressentiment und
partielle Kooperation durchaus vereinbar sind. Das zeigt sich auch am
politischen Katholizismus; er steht für eine fragwürdige Aufspaltung des
Antisemitismus in eine quasi "gerechte", gegen die Moderne generell sowie eine
angebliche jüdische Übermacht gerichtete Variante und einen "unchristlichen",
v. a. rassisch begründeten Judenhass. Selbst Erzberger zeigt die ambivalente
Haltung des Zentrums gegenüber dem Judentum. Dennoch unterstützten die Juden in
katholischen Gegenden häufig die Zentrumspartei und schmückten auf katholischen
Dörfern ihre Häuser zu christlichen Feiertagen. Schon Steiner war mit
antisemitischen Angriffen konfrontiert. Der Antisemitismus des Kaiserreichs
ist nicht scharf vom tradierten Antijudaismus abzugrenzen. Neu ist nur das
Element des sozialdarwinistisch argumentierenden Rassenwahns. Die Stoßrichtung
gegen eine als wesensmäßig fremd gebrandmarkte Gruppe, die jetzt kollektiv für
die Negativerscheinungen einer insgesamt oft ungeliebten Moderne verantwortlich
gemacht wird, folgt einem tradierten Muster. Erfolgreich ist der Antisemitismus
seit der Jahrhundertwende weniger als Bewegung denn als Ideologie von
Interessengruppen. Rapide soziale Umwälzungen und Enttäuschungen über
unerfüllte Versprechungen des Liberalismus wirken verhängnisvoll zusammen.
Der "Burgfrieden" 1914 gab den Juden möglicherweise mehr moralischen
Auftrieb als jedes andere Ereignis seit der Gleichberechtigung von 1869. Ein
Zeugnis des Fliegerleutnants Zürndorfer aus Rexingen zeigt den engen
Zusammenhang von Kriegsteilnahme und Emanzipationserwartung: "Ich bin als
Deutscher ins Feld gezogen, um mein bedrängtes Vaterland zu schützen, aber auch
als Jude, um die volle Gleichberechtigung meiner Glaubensbrüder zu erstreiten."
Für das Selbstverständnis der deutschen Juden und ihre Identitätskrise war
daher ein Ereignis in der Zeit des Ersten Weltkriegs 1916 traumatisch: Die
Anordnung des preußischen Kriegsministeriums über eine Erhebung der von Juden
im Heer bekleideten Positionen. Das Ergebnis wurde nicht bekannt gegeben. Nach
dem Kalkül der Judengegner sollte ihre Rolle im Krieg pauschal diskreditiert
werden.
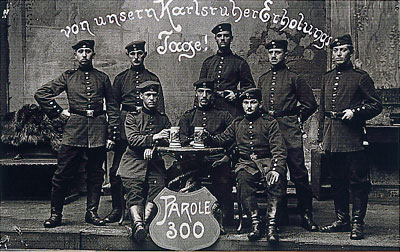
Jüdische Soldaten im Ersten Weltkrieg: "Von unsern Karlsruher Erholungs-Tage!"
©
www.lmz-bw.de

Denkmal für gefallene jüdische Soldaten des Ersten Weltkriegs auf dem jüdischen
Friedhof in Eppingen
© Schulenübergreifende Projektgruppe "Judentum im Kraichgau" (©
http://www.rsw.hd.bw.schule.de/shal/sha0.htm)
Der badischen Revolutionsregierung gehören zwei Juden an, Ludwig Haas und
Ludwig Marum - auch dies wie andernorts ein Ansatzpunkt für antisemitische
Agitation. Die Zeit der Weimarer Republik ist reichsweit einerseits noch
einmal gekennzeichnet von einer Hochphase der Teilhabe am öffentlichen Leben,
v. a. im kulturellen Bereich, andererseits hat die Aufstiegsbewegung der Juden
ihren Zenit überschritten und antisemitische Bedrohungen werden unverkennbar.
Der "Centralverein der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens" hatte sich
schon 1913 ausdrücklich gegen den Zionismus gestellt mit einem Bekenntnis zu
Deutschland und diese Haltung behielten die meisten nach dem Krieg bei. Der
Urbanisierungsprozess setzte sich fort, ebenso der Trend zu akademischen
Berufen - 1928 sind beispielsweise 28% der Karlsruher Ärzte und 40% der Anwälte
Juden.
Die Maßnahmen des NS-Staats ab 1933 zur schrittweisen Entrechtung der
jüdischen Bevölkerung traf unser Territorium im gleichen Maß wie das übrige
Reich. Ein Großteil der Synagogen fiel der Pogromnacht 1938 zum Opfer. Vermögen
wurde "arisiert". Einem Teil der Juden gelang die schwierige Emigration. Bei
den Deportationen gibt es zwischen beiden Ländern den Unterschied, dass im
Oktober 1940 4500 badische (außerdem pfälzische und saarländische) Juden in das
Gebiet der Vichy-Regierung deportiert werden, die selbst von der Aktion
überrascht wird. Sie weist die Betroffenen in das Internierungslager Gurs ein;
zwei Jahre später beginnen Deportationen von Gurs in die Vernichtungslager.
Über 70 % dieser ersten Deportation sterben. Das in Baden verbliebene Siebtel
wurde wie die Juden Württembergs in Vernichtungslager verschleppt. In
Württemberg führte der erste Transport im Dezember 1941 von Stuttgart nach
Riga; der weitaus größte Teil wurde direkt ermordet; drei weitere Deportationen
folgten 1942. Die Stuttgarter jüdische Gemeinde, seit 1939 einzige noch
existierende in Württemberg, wurde 1943 aufgelöst.

Mahnmal für jüdische NS-Opfer auf dem Stuttgarter
Pragfriedhof (1983)
©
www.lmz-bw.de
(Grenzemann)
Nach Kriegsende stellt sich für die wenigen Zurückgekehrten sowie die infolge des Krieges hier gestrandeten Displaced Persons, meist osteuropäischen Juden, die Frage, ob Juden überhaupt noch in Deutschland bleiben sollten. Jüdische Organisationen außerhalb Deutschlands sind dagegen. Aber die beiden Landesorganisationen, die Israelitische Kultusvereinigung Württemberg und der Oberrat der Israeliten Badens, entschieden sich anders, greifbar auch am Wiederaufbau bzw. Neubau der Synagogen (Stuttgart 1952, Karlsruhe 1971). Was Stern für die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Juden formuliert hat, gilt auch für diesen, dem Territorium unseres Bundeslandes gewidmeten Teil und seiner Behandlung in der Schule: Der jüdische Schmerz an Deutschland bleibt, doch ist er ein jüdischer ebenso wie ein deutscher Schmerz, aus dem nachgeborene Generationen nicht Betroffenheit schöpfen sollten, sondern Nachdenken, Optimismus, kritisches Erinnern und Anregungen für neues Gestalten."

Synagoge Heidelberg (2008)
©
www.lmz-bw.de (Weischer)
- Arbeitskreis für Landeskunde/Landesgeschichte RP Tübingen -



